„Moin Jung, wer nie Diesel gerochen hat, der hat auch nie Wind in den Segeln gespürt“ – so würd ich sagen, wenn wir am Kai stehen, Buddel in der Hand, und der Duft von altem Schiffsdiesel einem wie ’ne zweite Haut an den Klamotten klebt. Dat is Sprache, die nicht im Hörsaal gelernt wird, sondern im Maschinenraum, zwischen öligen Fingern und knarrendem Deck.
Moin, Ahoi und der ganze Buddelkram
Es gibt Wörter, Jung, die kennen Seeleute von Hamburg bis Singapur. Ob Fischer, Containerkapitän oder Bootsmann – wenn einer „Moin“ sagt, weiß der andere, dass hier kein Schauspieler steht. Kurz, knapp, wie ’n Kommando auf hoher See. „Ahoi“ is auch so’n Ding – klingt fast romantisch für die Touris, aber an der Hafenkante is es nur ein rauer Gruß, der durch den Qualm der Schornsteine weht.
Diesel-Deutschelingo
Zwischen den Kesselräumen hörst du ’nen ganz eigenen Klang. Worte wie „Schlepper“, „Backbord“, „Klabauter“ oder „Bunkerstation“ – die schmecken alle nach Diesel und Salz. Dat sind keine eleganten Begriffe wie in nem Büro. Dat sind Arbeitswörter, schwer wie Ankerkette, geformt im Rauch und Schweiß.
Und dann „Knoten“ – für’n Landei nur ’ne Schleife am Schuhband. Für’n Seemann aber das Maß für Geschwindigkeit. Wer mit achtzehn Knoten unterwegs is, zieht der Fähre am Kiel vorbei wie ’n Aal durchs Netz.
Seewolf-Kajüten-Kastl
- Was Sache ist: Seemannswörter sind nicht Dekoration, sondern Werkzeug. Sie sind Klartext-Kommandos, die Leben retten, wenn Schietwetter tobt.
- Tüddelkram: Touristen und landfeste Schnacker, die auf Hafenrundfahrt so tun, als wär „Ahoi“ ’n Modewort wie Latte Macchiato. Bidde nich!
- Rum-Fazit: Worte, die nach Diesel schmecken, sind nicht zum Spielen da. Sie tragen Geschichte, Schweiß und Wind in sich – wie Narben am alten Segeltuch. Ohne klare Sprache, Junge, kriegst du Chaos an Bord.
Hafenkneipen-Universalsprache
Ob in Rotterdam oder auf den Philippinen – ’n alter Seemann versteht sofort, wenn einer „Maschine stopp“ brüllt oder „Anker auf!“ ruft. Diese Wörter sind international, weil sie nicht aus’m Wörterbuch, sondern aus’m Bauch kommen. Wer auf See war, übersetzt instinktiv.
Und dann gibt’s diese geheimen kleinen Brocken, die nur alte Hasen wirklich fühlen: „Schlick“, „Schapp“, „Schott dicht“. Das sind Worte, die sofort Bilder malen – nasse Handschuhe, quietschendes Metall, Dieselgeruch im Rachen.
Warum die Sprache wie Diesel ist
Weil sie bleibt. Diesel frisst sich in jede Pore, genau wie die Wörter in die Köpfe der Matrosen. Man kann’s auswaschen, schrubben, fluchen – trotzdem, das Zeug bleibt. So wie die Sprache. Rugged, unverwüstlich, resistent gegen Mode und Marketing.
Und zum Schluss, Jung, merk dir: Wenn dir einer erzählt, dass Sprache saubär wie ’n Neubau-Badezimmer sein muss – lach ihn aus. Wahre Wörter stinken nach Diesel, schmecken nach Schweiß und klingen wie ’ne rostige Schiffsglocke bei Sturm. Wer dat nicht mag, soll Latte trinken und leise sein.
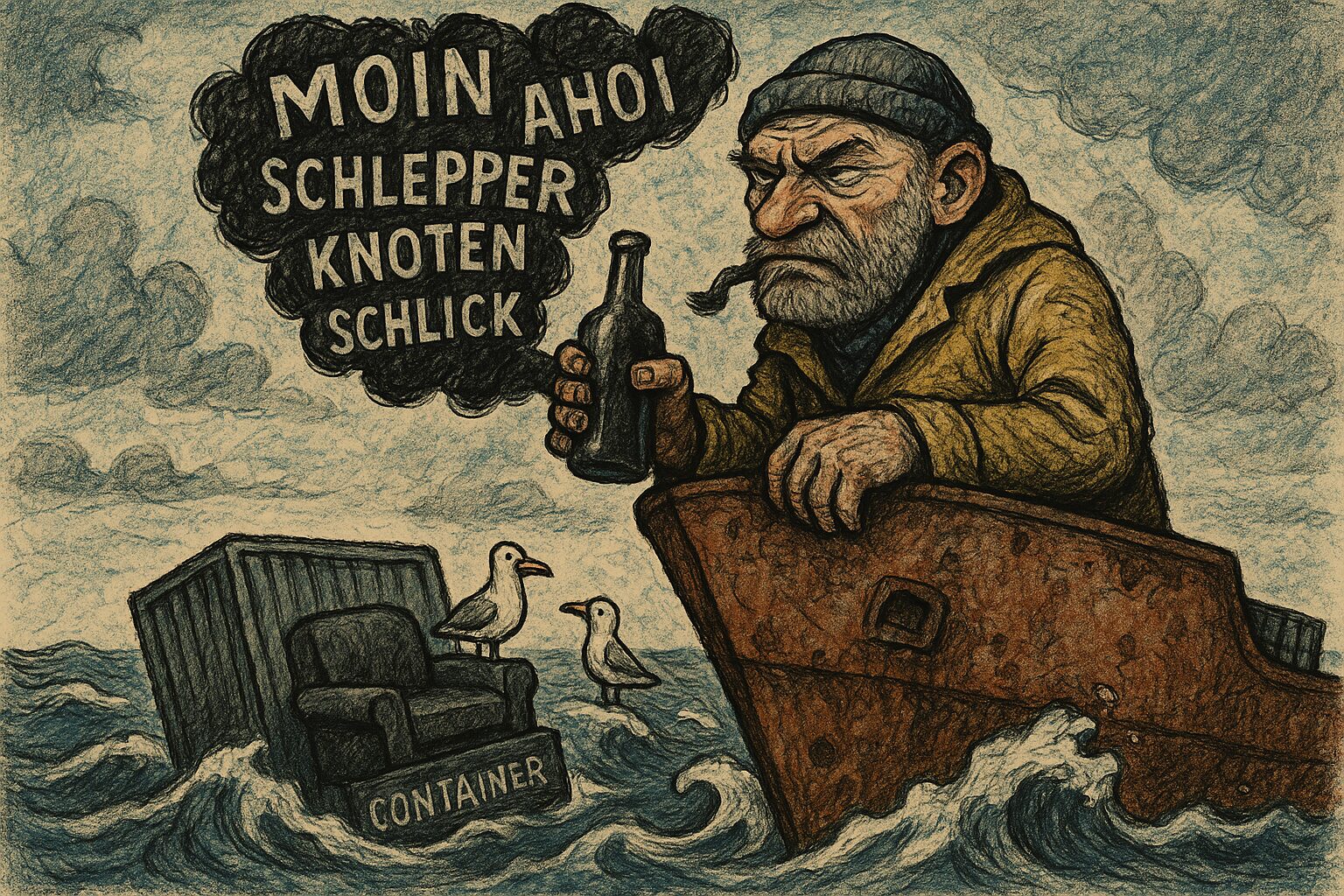

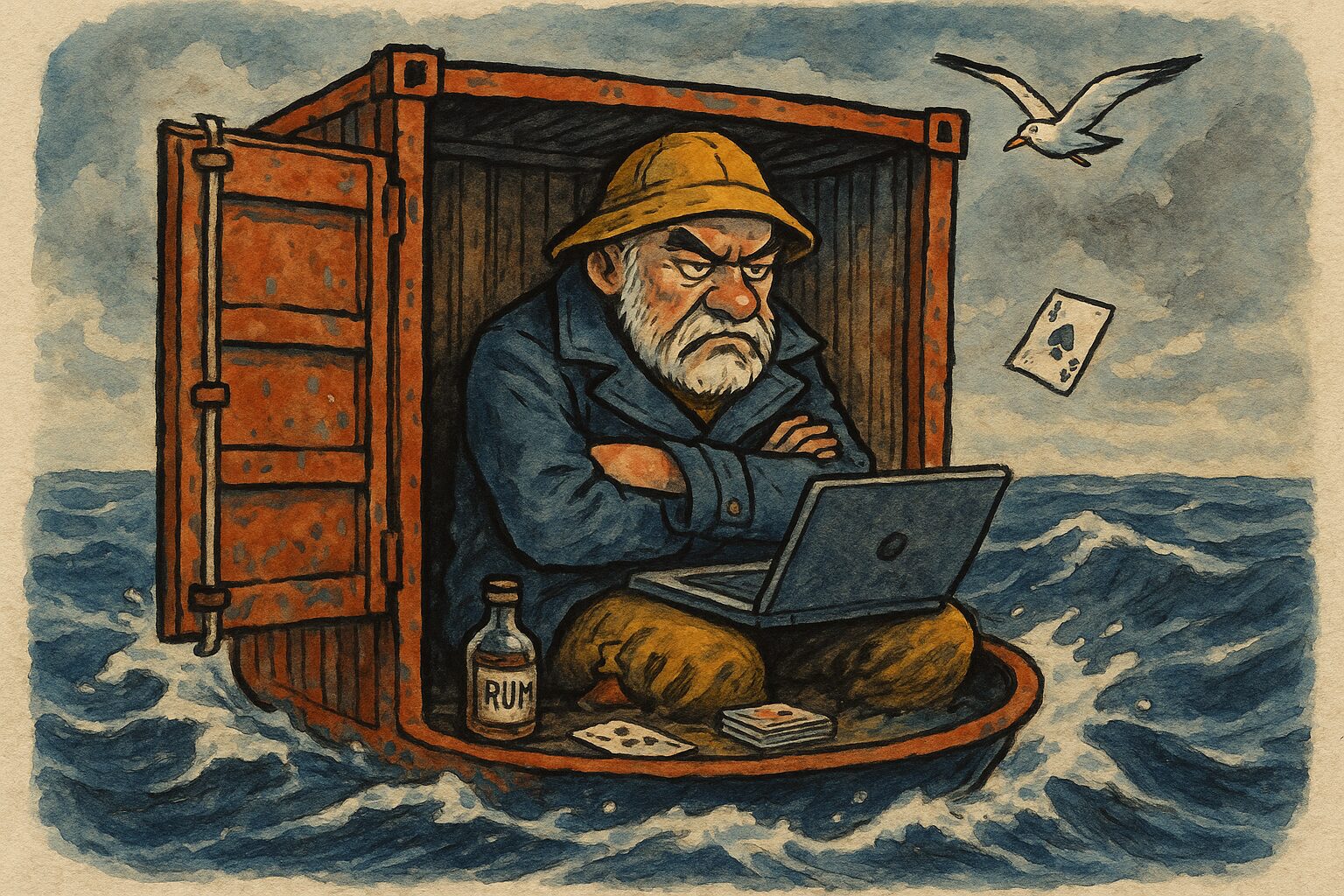
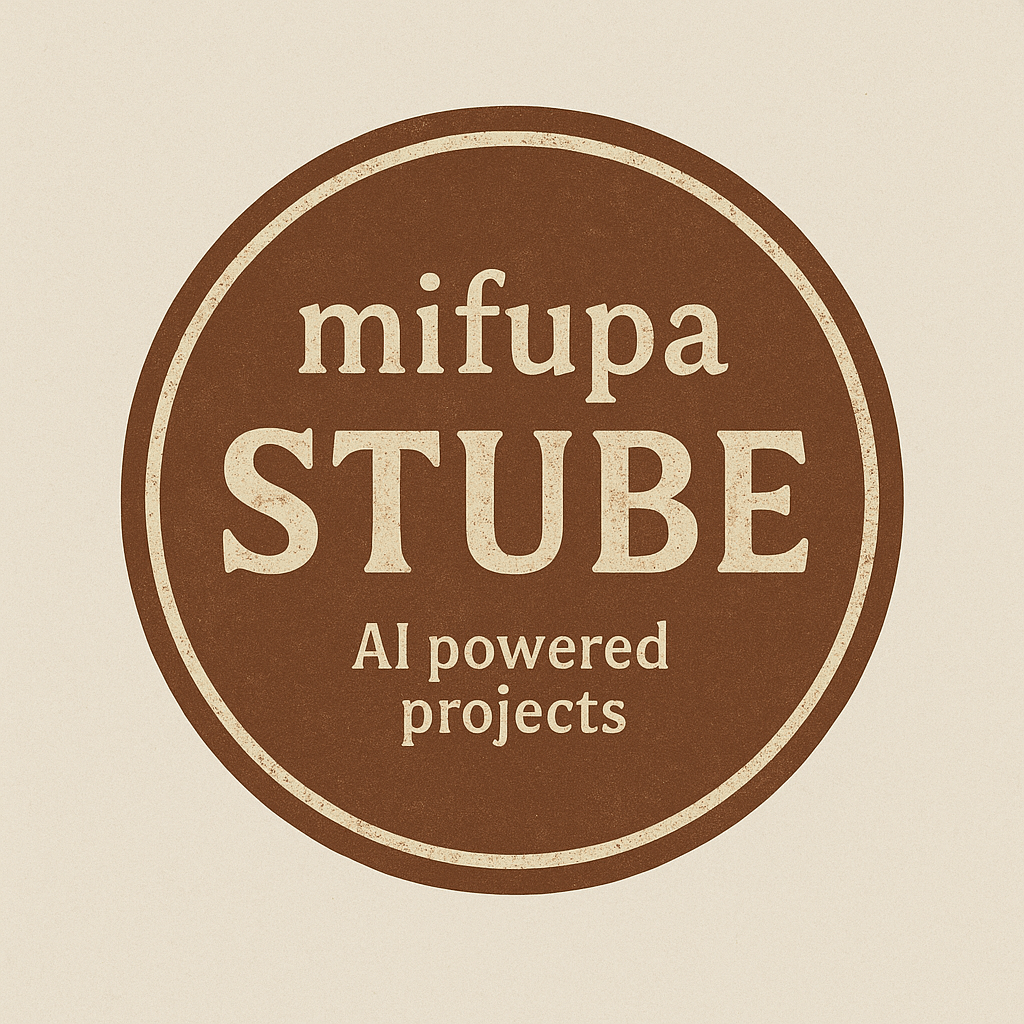
Mach den ersten Wurf ins Logbuch bei crew.bananenschwein.de